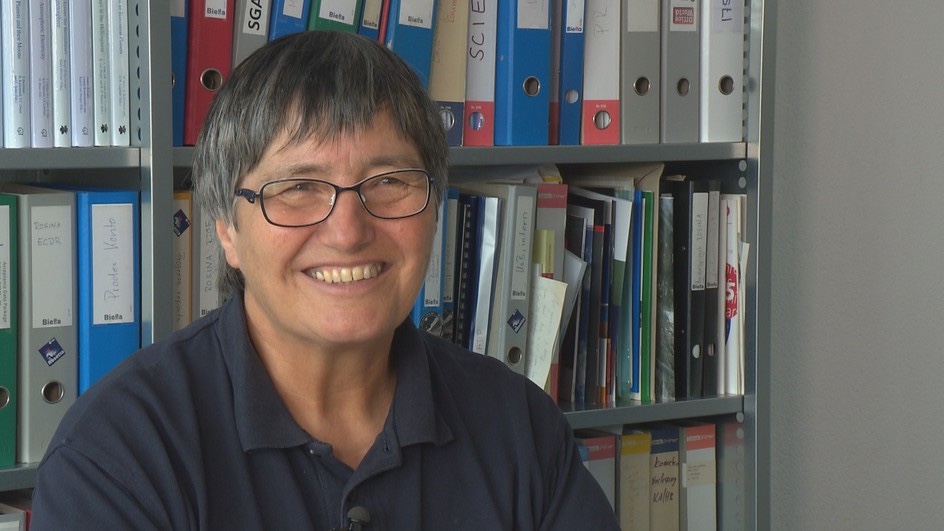Susanne Wille (*1974) kennt fast jede_r in der Schweiz. Die Politjournalistin arbeitet für das Nachrichtenmagazin 10vor10, moderiert diverse Sendungen und realisiert Reportage-Serien aus der ganzen Welt.
Frau Wille, Sie sind schon lange im Journalismus tätig. Wie hat sich die Nachrichtenwelt in den letzten Jahren verändert?
Sie hat sich stark verändert. Wenn ich meine erste Nachrichtensendung vor 18 Jahren mit einer Sendung von heute vergleiche, wird das deutlich. Ich fasse den Wandel mit drei Schlagwörtern zusammen: Tempo, Transparenz, Treffpunkt.
Stichwort Tempo: Das Nachrichtengeschäft ist viel schneller geworden. News, Videos, Schlagzeilen werden rund um die Uhr um den Globus gejagt, sind für alle jederzeit zugänglich. Wer heute eine Nachrichtensendung um 10vor10 schaut, hat meist das Wichtigste schon mitbekommen, via Internet oder Smartphone. Darum ordnen wir das Geschehene noch stärker ein als früher und setzen auf einen Schwerpunkt pro Sendung, um die News zu vertiefen. Wir dürfen dabei aber nicht nur an die eigene Sendung denken. Unsere zentralen Geschichten müssen schon vorher auf unserem Webangebot zu finden sein. Denn immer mehr Menschen informieren sich online.
Der zweite grosse Begriff ist Transparenz. Heute müssen wir stärker erklären, warum wir auf ein bestimmtes Thema setzten, wie wir bei einer Recherche vorgehen, warum wir diesen Gast eingeladen haben und nicht jenen. Denn unser Publikum schaut kritisch hin und gibt Rückmeldungen. Früher gefielen wir Journalisten uns in der Rolle jener, die quasi die alleinige Deutungshoheit über ein Ereignis hatten, und es war nicht Standard, dass wir dem Publikum das journalistische Handwerk und die publizistischen Mechanismen aufzeigten. Doch genau das ist heute entscheidend, besonders in Zeiten von Fake News. (Ein Wort, das ich übrigens höchst ungern benutze, da falsche News keine News sind. Ich wähle es hier, um die Problematik des Vertrauensverlustes zu skizzieren.) Wollen wir aufzeigen, wie sehr wir uns bemühen, stets auf akkurate, verifizierbare Nachrichten zu setzen, müssen wir uns erklären und transparent sein. So zeige ich zum Beispiel auf den sozialen Medien Videos, die einen Blick hinter die Kulissen des Nachrichtengeschäfts liefern. Ein kleiner Beitrag, hier können wir noch ausbauen. Das hat auch mit dem dritten Begriff zu tun.
Der Treffpunkt. Eine Nachrichtensendung ist heute keine Einbahnstrasse mehr. Social Media hat die Spielregeln komplett verändert. Das Publikum diskutiert, stellt Fragen, kritisiert. Und erwartet Antworten. Ich bin als Journalistin also näher am Publikum als früher. Das heisst auch, meine Arbeit geht nach dem Lichterlöschen im Studio noch weiter. Aber das ist es mir wert.
Ein grosses Engagement! – Was genau macht die Faszination Ihrer Arbeit aus?
So viel sich verändert hat, wie ich es grad geschildert habe, so viel ist zum Glück auch gleich geblieben. Journalismus ist immer noch ein entscheidender Grundpfeiler einer funktionierenden Demokratie. Journalismus erzählt packende Geschichten, deckt Missstände auf, hinterfragt die Macht und trägt zur Meinungsbildung bei. Journalismus ist nie still, sagte mal jemand. Dieses stete Hinschauen und Weitedenken fasziniert mich noch immer. Und keiner meiner Tage verläuft gleich.
Sind Sie lieber im Studio tätig oder unterwegs?
Das Studio ist wie ein Fixpunkt. Eine Verankerung für das, was die Newswelt den Tag über beschäftigt hat. Hier fliessen die Geschichten und Interviews zusammen. Hier ordne ich das Geschehene ein: den Irandeal, die Steuervorlage, die Wahlen in Schweden. Hier führe ich Live-Gespräche mit Gästen – was ich übrigens am liebsten mache.
Als Journalistin oder Politmoderatorin unterwegs zu sein, bedeutet, den Puls zu spüren, bedeutet, mit den Menschen zu reden. Die Kombination von beiden Welten: Studio und on the road zu sein, ist sicher ideal.
Weiterentwicklung und strategische Neuausrichtung
Aber für mich ist derzeit eine andere Frage zentral: Die Medienwelt ist in einem grossen Umbruch, SRF muss sich für die Zukunft rüsten. Hier bin ich im Projektteam, das sich mit der Weiterentwicklung und der strategischen Neuausrichtung des Nachrichtenangebots befasst. Diese Verantwortung hat Priorität. Also statt den Rucksack zu schultern, um auf Reportage zu gehen, setz ich mich lieber mit unserem journalistischen Angebot und den grossen Fragen auseinander. Wie erreichen wir die jungen Menschen? Wie gelangen unsere Newsangebote zu den Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie weniger zu fixen Zeiten vor dem TV-Gerät sitzen? Wie halten wir die Qualität, wenn Tempo und Druck steigen? Dass wir künftig noch guten Journalismus machen können, darauf kommt es an. Und dafür will ich mich einsetzen.
Ihr Job ist intensiv und doch wirken Sie immer entspannt. Gibt es dafür ein Geheimrezept?
In einem meiner Führungskurse sagte ein Dozent: «Hektik macht dumm.» Das unterstreiche ich voll und ganz. In der Hektik wird man ungenau, verliert das Einfühlungsvermögen und übersieht Wichtiges. Also versuche ich, so gut es geht, Hektik zu vermeiden, auch wenn es bei uns oft um Sekunden geht und der Druck hoch ist. Aber: Ich machte im arabischen Frühling Sondersendungen ohne einen einzigen Satz notiert zu haben, ich erlebte, wie ein zugeschalteter Gast aus Brüssel mitten in einer Live-Schaltung zum Thema Steuerflucht in unserem Gespräch einen Anruf auf seinem Mobiltelefon entgegennahm, ich musste am WEF in Davos eine Live-Debatte abbrechen, weil ein ranghoher ausländischer Politiker in der ersten Reihe ohnmächtig wurde. Ich hätte noch viele andere Beispiele. Solche Erlebnisse stärken automatisch die Nerven. Aber das heisst nicht, dass ich immer tiefenentspannt bin. Nein, das ist unmöglich. Aber ich wende tatsächlich immer den gleichen Trick an. Wenn es hektisch zu- und hergeht und alles um mich herum wuselt, dann schaue ich immer, dass die (Vor-)Freude grösser wird als die Nervosität. Wenn ich auf dem Balkon beim Brandenburger Tor wenige Minuten vor dem Start einer Wahlsendung stehe, bei der alles passieren kann, denke ich nicht an Leitungen, die noch nicht stehen, ans Ungewisse: Ich freue mich auf die Sendung. Das ist Rock ’n‘ Roll und Politgeschichte live und wir sind mittendrin.
Wie sehen Sie die Zukunft des Journalismus?
Die Zeiten des Umbruchs sind noch lange nicht vorbei. Der ökonomische Druck hält an, Werbeeinnahmen brechen weg. Aber auch unser öffentliches Medienhaus, das Gebühren bekommt, bewegt sich und muss sich weiterbewegen, damit wir auch fortan guten Journalismus machen, die Menschen erreichen können. SRF hat den Auftrag, zur Meinungsbildung beizutragen. Also müssen wir auch dort präsent sein, wo die Meinungen gebildet werden. Und das ist zunehmend im mobilen, digitalen Bereich. Wir setzen also noch stärker auf Videoformate für alle digitalen Kanäle. Die Welt dreht schneller, also muss auch SRF noch schneller reagieren können. Darum bauen wir zudem die Redaktionen um. Bis jetzt arbeiten Reporterinnen und Reporter entweder für die Tagesschau, Schweiz Aktuell oder 10vor10. Neu sind wir ab November in Fachredaktionen organisiert. Die Journalistinnen und Journalisten haben eine Dossierverantwortung in den Bereichen Wirtschaft, Inland, Ausland. Mehr Fachkompetenz also für noch mehr Einordnung.
Aber bei allen Veränderungen in der Branche: Etwas wird es meiner Meinung nach immer geben: den Wunsch nach gut recherchierten Geschichten.
Einer der Sprüche, die meine Bürowand schmücken, ist von Rainer Malkowski. Er sagte einmal «Als genug Verzweiflung vorhanden war, ist das Achselzucken in die Welt gekommen.» Genau dagegen muss der Journalismus ankämpfen. Denn das Achselzucken würde bedeuten, dass die Gesellschaft gleichgültig und somit am Ende wäre. Wir Medienschaffenden müssen uns dafür einsetzen, dass sich alle mit unserer Welt auseinandersetzen, an ihr arbeiten, so kompliziert und unübersichtlich diese Welt uns bisweilen auch vorkommt
Und noch eine Frage zum Schluss: Gibt es Frauen, die man unbedingt kennen muss?
Eigentlich meine langjährigen Freundinnen. Sie sind klug, abenteuerlustig, stark und loyal. Wir haben zusammen so viel erlebt, dass es für mehrere Leben reicht. Aber da ich Berufliches und Privates so gut es geht trenne, bin ich nicht unglücklich, wenn ich meine grossartige Frauenbande nicht mit der Öffentlichkeit teilen muss.
Foto: © SRF/Miriam Künzli
> SRF
> 10vor10
 Dr. Helen Keller: Ich habe mich rund zehn Jahre mit völker- und menschenrechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Mein Fokus in der Forschung war die Schnittstelle zwischen internationalem und nationalem Recht. Mich interessierte die Frage: Wie funktionieren internationale Gerichte und wie reagieren die nationalen Instanzen auf die internationalen Entscheide? Das war eine gute Voraussetzung, um Richterin zu werden. Richterin am Europäischen Gerichtshof wird man allerdings nicht aufgrund einer bestimmten Karriere, sondern durch viel harte Arbeit und Engagement. Schliesslich muss frau im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein und den Mut haben, die Gelegenheit beim Schopf zu packen.
Dr. Helen Keller: Ich habe mich rund zehn Jahre mit völker- und menschenrechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Mein Fokus in der Forschung war die Schnittstelle zwischen internationalem und nationalem Recht. Mich interessierte die Frage: Wie funktionieren internationale Gerichte und wie reagieren die nationalen Instanzen auf die internationalen Entscheide? Das war eine gute Voraussetzung, um Richterin zu werden. Richterin am Europäischen Gerichtshof wird man allerdings nicht aufgrund einer bestimmten Karriere, sondern durch viel harte Arbeit und Engagement. Schliesslich muss frau im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein und den Mut haben, die Gelegenheit beim Schopf zu packen.


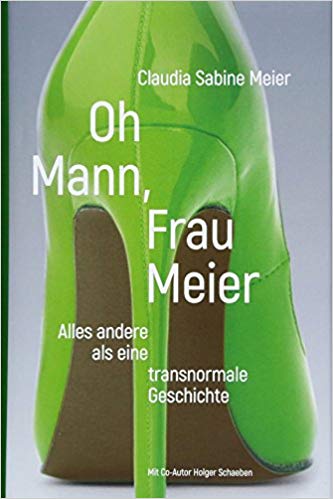



 Julia Hofstetter (*1971 ) ist unter anderem als Hirtin von sieben Stadtziegen in Zürich Nord tätig.
Julia Hofstetter (*1971 ) ist unter anderem als Hirtin von sieben Stadtziegen in Zürich Nord tätig.