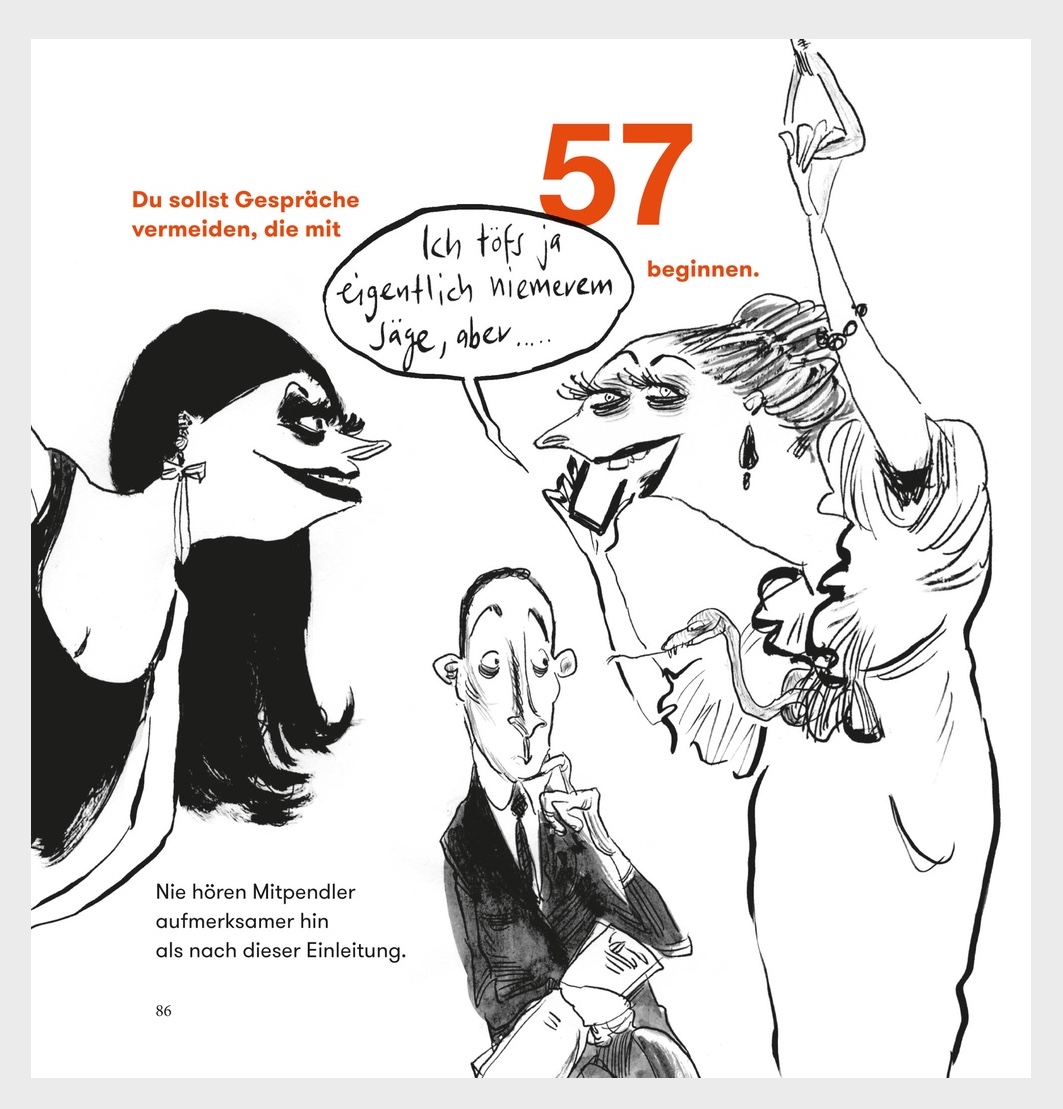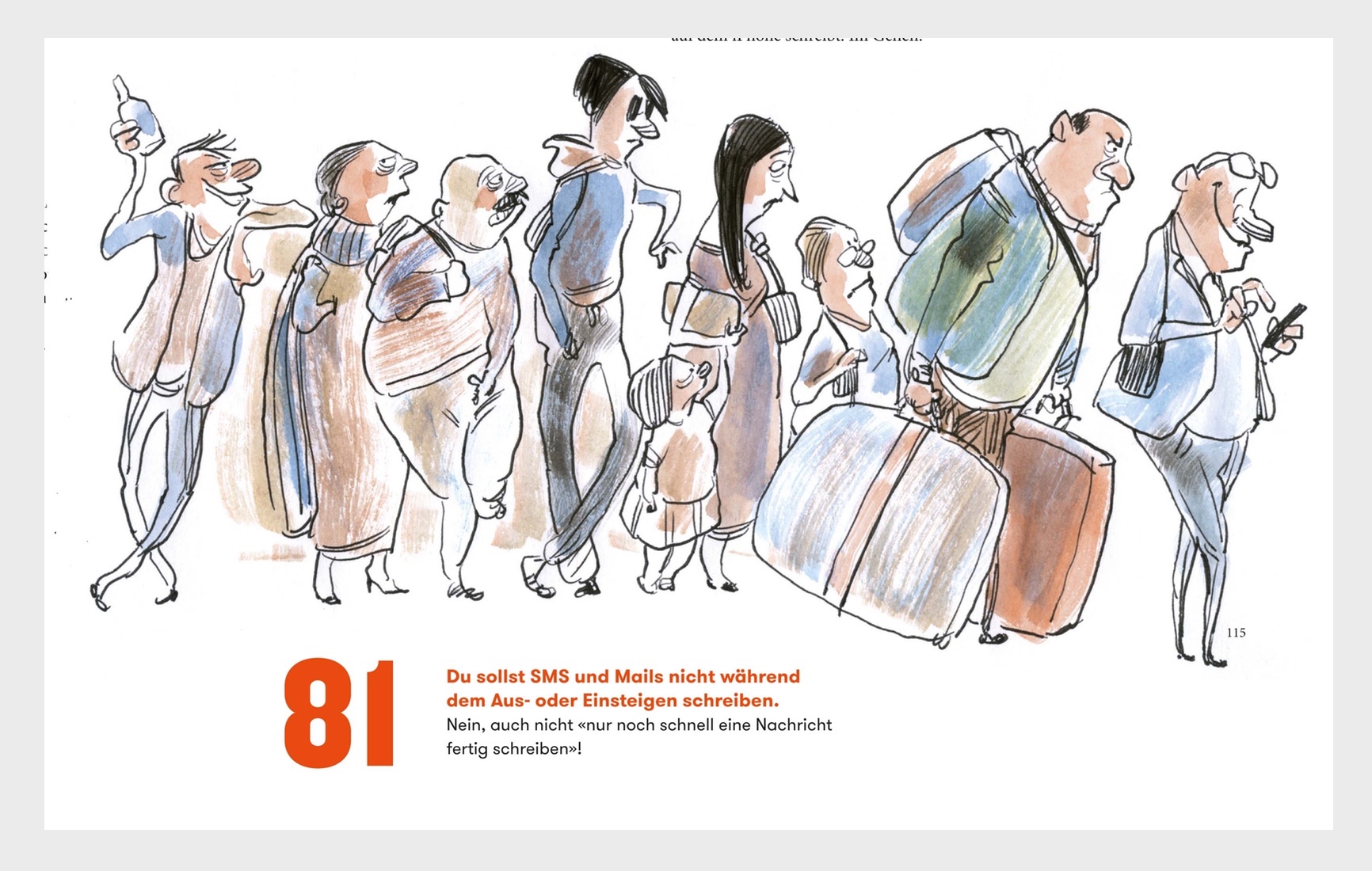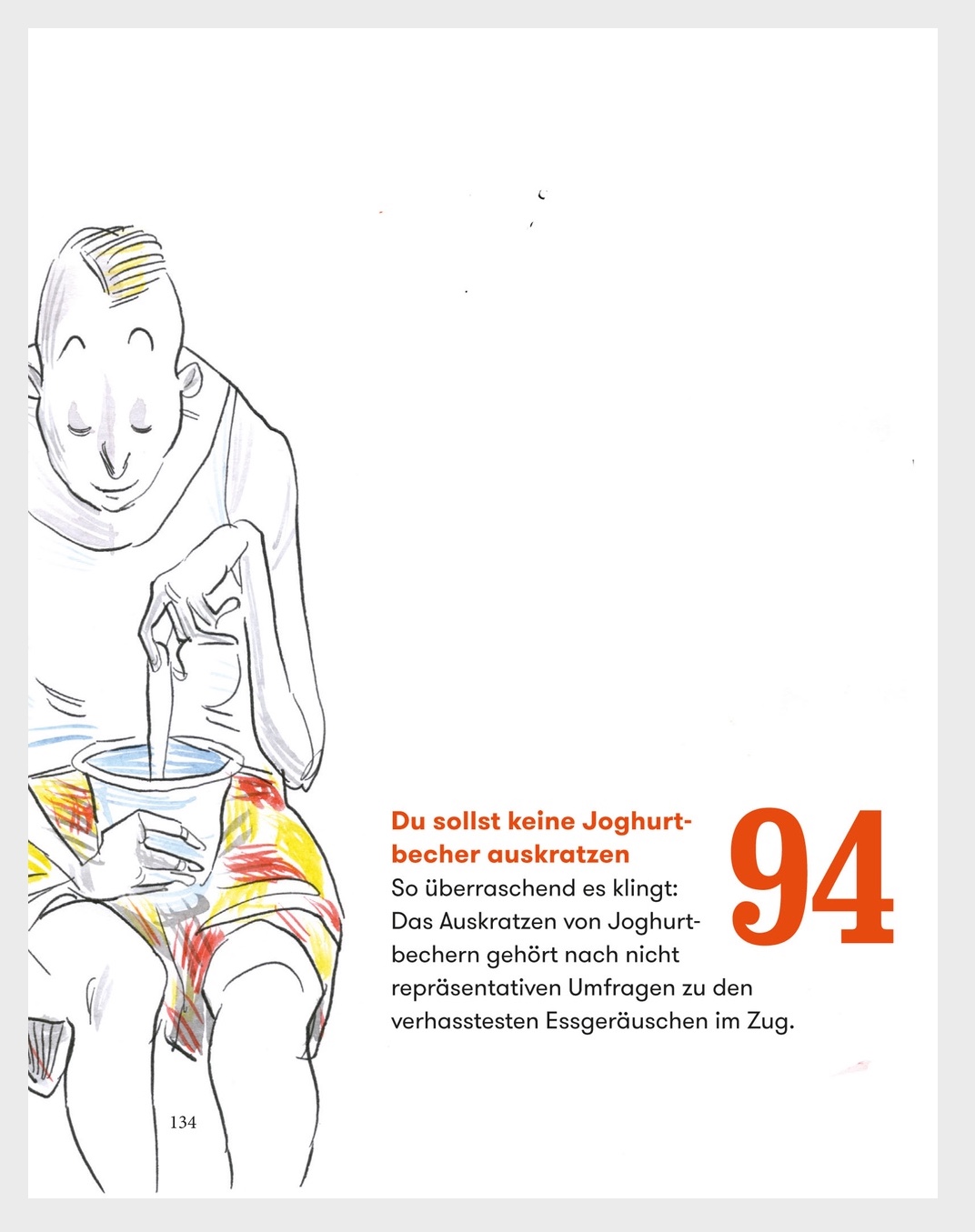Ariane Stäubli ist eine der wenigen Bergführerinnen in der Schweiz. Ausserdem schloss sie als erste Frau die Gebirgsspezialisten-Rekrutenschule (RS) in Andermatt ab. Wenn Ariane Stäubli nicht in den Bergen unterwegs ist, arbeitet sie als Umweltingenieurin mit den Schwerpunkten Verfahrenstechnik, Recycling und Modellierung von Rohstoffkreisläufen.
 Frau Stäubli, woher kommt Ihre Liebe zu den Bergen?
Frau Stäubli, woher kommt Ihre Liebe zu den Bergen?
Ariane Stäubli: Schon als kleines Mädchen kletterte ich bei Föhnsturm am liebsten in die Wipfel der höchsten Bäume. Später war ich in jeder freien Minute mit meinen Freunden, meiner Schwester oder der Jugendgruppe des Schweizer Alpenclubs SAC in den Bergen unterwegs. Als kleiner Mensch in der grossartigen Wildnis unserer Bergwelt unterwegs zu sein, relativiert vieles und stimmt demütig. In den Bergen habe ich das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das richtige zu tun. Ich fühle mich frei.
Was sind die Aufgaben einer Bergführerin?
Als Bergführerin begleite ich Menschen auf verschiedenen Routen und Wegen durch die Berge. Sei es über einen luftigen Felsgrat, weite Gletscher oder auf einer pulvrigen Tiefschnee-Skiabfahrt. Dabei ist mir wichtig, den Gästen meine Begeisterung für die Berge und die Natur mitzugeben und sie auch durch anspruchsvolles Gelände möglichst sicher zu führen. Bergsteigen ist verdichtetes Leben, auf einen schattigen, anstrengenden Aufstieg folgt meist ein sonniges Gipfelerlebnis. Es macht mich glücklich, Menschen bei persönlichen Grenzerfahrungen zu begleiten.
 In der Schweiz gibt es rund 36 Bergführerinnen und rund 1’500 Bergführer. Wie ist es als Frau in der Bergführerszene? Muss man da ein besonders dickes Fell haben?
In der Schweiz gibt es rund 36 Bergführerinnen und rund 1’500 Bergführer. Wie ist es als Frau in der Bergführerszene? Muss man da ein besonders dickes Fell haben?
Während der Bergführerausbildung habe ich fehlende körperliche Kraft durch einen unbändigen Willen kompensiert. Nun fühle ich mich als Frau sehr gut aufgehoben in der Familie der Bergführer. Kameradschaftlichkeit ist mir unglaublich wichtig, ich gehe gerne auf Menschen zu und es freut mich immer sehr, in den Berghütten oder auf meinen Touren bekannte Gesichter zu treffen. Einzig gewisse Gäste sind bei der ersten Begegnung manchmal erstaunt, wenn vor ihnen nicht ein stämmiger, männlicher Bergführer steht. Mit Fachkompetenz und Charme lässt sich aber meist schnell eine gute Atmosphäre schaffen.
Erlebten Sie in den Bergen auch schon schwierige Momente?
Vor ein paar Jahren hatte ich einen schweren Skitourenunfall, bei dem ich 500 Höhenmeter abgestürzt bin. Während des Falls sah ich ein gleissendes, weisses Licht und war mir sicher, dass ich nun gestorben bin. Erstaunlicherweise war dies kein unangenehmes Gefühl, eher eine neutrale Feststellung. Wie durch ein Wunder habe ich überlebt, allerdings mit einer sehr schweren Knieverletzung. Ob ich jemals wieder gehen kann, war lange ungewiss. Mental war sie Situation sehr schwierig, ich fragte mich, ob ich nach den Sternen greifen darf und mir weiterhin die Bergführerausbildung als Ziel setzten soll, oder ob ich die Ansprüche an meinen Körper drastisch reduzieren muss. Glücklicherweise haben mich meine Familie und meine Freunde beim Rehabilitations-Prozess enorm unterstützt und mein Traum, Bergführerin zu werden, wurde nach einem langen Leidensweg doch noch wahr. Schlussendlich hat mir der Unfall die Angst vor dem Tod genommen und lässt mich mein Leben doppelt geniessen.
Sie haben an einem Filmprojekt über Bergführerinnen von Caroline Fink mitgemacht, das von SRF co-produziert wird. Wann feiert der Film Premiere?
Im Frühling 2019.
Webseite von Ariane Stäubli: www.bergfuehrerei.ch






 Frau Studhalter-Gasser, wie wird man Feuerschluckerin?
Frau Studhalter-Gasser, wie wird man Feuerschluckerin?